- Aktuell
- Bücher
- Hörspiele und Videos
- Lesungen
- Science Slam
- Geschichts wissenschaft
- Biografie
- Fotos
- Schreibtipps
- Einleitung
- Kreatitivät
- Aus dem Auge des Sturms - Autorenthemen
- Schreiben am Abgrund? Der Autor als Beruf
- Die Emoji-Falle
- Gastbeitrag Olga Krouk: Emoji-Flut? Ja, bitte! Aber bitte richtig
- Schreit ein König Scheiße? Autoren und ihre Recherche
- Gastbeitrag Rebecca Timm: Wie ich zu einer Agentur und zu einem Verlag fand
- Gastbeitrag Gabriella Queen: Kleinverlag oder Keinverlag?
- Gastbeitrag Monika Pfundmeier: Schreiben und Erfolg
- Gastbeitrag Britta Wisniewski: Pseudonyme
- Gastbeitrag Jasmin Jülicher: Veranstaltungen - woher nehmen?
- Gastbeitrag Christina Willemse: Wie organisiere ich eine Buchveranstaltung?
- Gastbeitrag Scarlett Posch: Ein Bücherblog für SPler
- Gastbeitrag Cathryn Holister: Branding für Autoren
- Gastbeitrag Mina Miller: Psst ... Ich schreibe einen erotischen Roman
- Gastbeitrag Lisa Richter: Autorin auf der Schulbank
- Gastbeitrag Doris Gapp: Satire
- Gastbeitrag Mia Lada-Klein: Über das Schreiben von Tabus
- Gestrandet auf dem Ozean der Träume
- Gastbeitrag A. Baron: Willkommen zu Deiner Thriller-Therapie
- Gastbeitrag Dorina Wessendorf: ENDE ist nur ein Wort
- Gastbeitrag Max Winkel: Betende Kinder
- Werkstatt der Autoren
- Stefanie Eisert: Maleficent
- Kathrin Szkola: Naruto
- Madelin Minutella: Entdecke die Welt in Dir
- Fabrice Arendt: Meine Geschichte
- Lisa Völker: Warum Malen das Schreiben leichter macht
- Annika Ponten: Schreiben - Ein Ausdruck meiner Selbst
- Julia Berchem: Hauptberuflich Autor*in
- Angela Pehl: Wenn eine Idee eine Kettenreaktion auslöst
- Alicia Wingender: Über das Schreiben, schreiben
- Sarah Diedring: Gnadenlos
- Freya Pauluschke: Abtauchen
- Clarissa Nguyen: Das perfekte Märchen
- Julia Cirkel: Fan-Fiction
- Kim Radtke: Knives Out
- Vianne Niegemann: Schau dir mal die Wolken an
- Mara Gosdzick: Geschichten abschließen
- Sude Kesik: Monster (Kurzgeschichte)
- Tipps: Bücher, Musik, Filme, Kino
- Bücher
- Befreundete Autor*Innen
- Musik
- Dire Straits - Love over gold
- Amy MacDonald - This is the life
- The Doors - Waiting for the sun
- Element of Crime - Weißes Papier
- NOFX - Ribbed
- Dream Theater - A dramatic turn of events
- Blind Guardian - Beyond the red mirror
- Iron Maiden - Somewhere in time
- Megadeth - Rust in peace
- Slayer - Hell awaits
- Mark Knopfler live Oberhausen 1.7.19
- Filme
- Kino
- Privates und Sonstiges
- Mal wieder im Kino gewesen ...
- James Bond - No time to die
- Peninsula
- Jim Knopf und die Wilde 13
- Vergiftete Wahrheit
- Eine Frau mit berauschenden Talenten
- Hello again
- New Mutants
- Tenet
- The secret
- The witch next door
- Onward
- Follow me
- Top 5 und Flop 5 Januar bis März 2020
- Der Spion von nebenan
- Die Känguru-Chroniken
- Bloodshot
- The Gentlemen
- Der Unsichtbare
- Dr. Dolittle
- Brahms: The Boy 2
- Bombshell
- Fantasy Island
- 21 Bridges
- Enkel für Anfänger
- The Lodge
- Birds of Prey
- Underwater
- Knives Out
- Motherless Brooklyn
- Flop 10 2019
- Top 10 2019
- Top 5 und Flop 5 von Oktober bis Dezember
- Star Wars - Der Aufstieg Skywalkers
- Jumanji 2
- Black Christmas
- Zombieland 2
- Hustlers
- Der letzte Bulle
- Doctor Sleeps Erwachen
- Terminator: Dark Fate
- Das perfekte Geheimnis
- Scary stories to tell in the dark
- Parasite
- Ready or not
- Gemini Man
- Joker
- Midsommar
- Die Top 5 und Flop 5 von Juli bis September
- Ad Astra
- Once upon a time ... in Hollywood
- Late Night
- Es - Kapitel 2
- Good Boys
- Little Monsters
- I am Mother
- Angel has fallen
- Stuber
- Crawl
- Fast & Furious: Hobbs & Shaw
- Annabelle 3
- Child's Play
- Anna
- Spiderman: Far from home
- Die Flop 5 von April bis Juni
- Die Top 5 von April bis Juni
- Die Top 5 und Flop 5 von Januar bis März
- Flop 10 im Jahr 2018
- Top 10 im Jahr 2018
- Aquaman
- Operation Overlord
- Bohemian Rhapsody
- The Happytime Murders
- Bad times at the El Royale
- Abgeschnitten
- The Guilty
- Venom
- Book Club
- Die Top 5 und Flop 5 von Juli bis September
- Die Unglaublichen 2
- Das Haus der geheimnisvollen Uhren
- Searching
- I can only imagine
- Blackkklansman
- Mile 22
- Predator - Upgrade
- Full Circle
- The Nun
- Slender Man
- The Darkest Minds
- Bad Spies
- Action Point
- The Domestics
- Breaking in
- Equalizer 2
- Christopher Robin
- Die dunkelste Stunde
- Meg
- Catch me!
- Mission: Impossible - Fallout
- Ant-Man and the Wasp
- Hotel Artemis
- Sicario 2
- Hotel Transsilvanien 3
- Super Troopers 2
- Skyscraper
- The first Purge
- How to party with Mom
- Papst Franziskus
- Meine teuflisch gute Freundin
- Die Top 5 und Flop 5 von April bis Juni
- Ocean's 8
- Nicht ohne Eltern
- Hereditary - Das Vermächtnis
- Jurassic World - The Fallen Kingdom
- Luis und die Aliens
- I feel pretty
- Solo - A Star Wars Story
- Deadpool 2
- Rampage
- Sherlock Gnomes
- Avengers - Infinity war
- Der Sex-Pakt
- A quiet place
- Ghost Stories
- Gringo
- Das Zeiträtsel
- Ghostland
- Ready Player One
- Pacific Rim – Uprising
- Die Top 5 und die Flop 5 von Januar bis März
- Unsane - Ausgeliefert
- Die Sch'tis in Paris
- Jim Knopf
- Peter Hase
- Tomb Raider
- Winchester - Haus der Verdammten
- Death Wish
- Red Sparrow
- Game Night
- Hilfe, ich habe meine Eltern geschrumpft
- Heilstätten
- Alles Geld der Welt
- Black Panther
- Wind River
- Criminal Squad
- I, Tonya
- Die kleine Hexe
- Three billboards outside Ebbing, Missouri
- Das Leben ist ein Fest
- It comes at night
- Downsizing
- Shape of water
- Greatest Showman
- The Commuter
- Homo Narrans Podcast
- Ravendonk - Blogger-Team
- Presse
- Shop
- Kontakt
- Links
- Bands
Bohemian Rhapsody (Start: 30.10.2018)
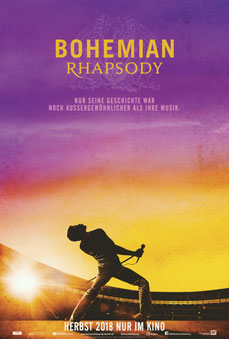
Als ich mich so 1989 für Musik zu interessieren begann, waren Queen mit „The Miracle“ schon vorne dabei. Vom letzten Mercury-Album „Innuendo“ (1991) fand ich dann das Titelstück dermaßen faszinierend, dass ich es mir sofort gekauft habe. Doch merkte ich auch, dass Queen eine sehr große Bandbreite an Stilen in ihrer Musik vereinen und viel experimentieren, was ich damals nicht so zu schätzen wusste wie heute. Also bin ich nie so ein beinharter Fan geworden. Die „Greatest Hits“ und „Live Magic“ hatte ich, „Bohemian Rhapsody“ gehörte dank „Waynes World“ zum Standard, das war es dann aber auch. Dank der stetigen Betonung meiner Lieblingsband Blind Guardian, dass „A Night At The Opera“ eines der besten Alben aller Zeiten sei, habe ich es mir irgendwann viel später gekauft und fand es tatsächlich sehr beeindruckend. Dieses Jahr kam „Live Killers“ hinzu, eine Platte, die diesen Namen mehr als verdient. Kurz gesagt: Queen verfolgen mich mein Leben lang und irgendwann werden sie mich wohl noch einholen.
Vielleicht ist es Ihnen jetzt gelungen. Seit dem ersten Trailer vor Monaten habe ich auf den Film „Bohemian Rhapsody“ gewartet. Ich wollte einfach wissen, was die Faszination dieser Band eigentlich ausmacht. Nicht alle verfilmten Musiker- und Bandbiografien sind dafür geeignet, aber manche schaffen das. Ganz vorne war da für mich immer der „Doors“-Film. Bis jetzt. Denn „Bohemian Rhapsody“ ist da allerhärteste Konkurrenz!
Kurz und gut: Ich fand den Film großartig, aber es war eine Achterbahnfahrt. Der Anfang ist grandios gelungen, zwischendurch scheint er ein wenig in die Skandalecke abzudriften, um dann aber in eindrucksvoller Weise zum Ende den legendären Auftritt der Band beim Live Aid zu inszenieren. Unter dem Eindruck dieser Bilder und nachdem ich mir noch einmal das Original angesehen habe, kann ich sagen, dass es tatsächlich eines der besten Rockkonzerte aller Zeiten gewesen ist. Wie komme ich darauf? Der Film spricht es mehr als deutlich aus.
Queen sind zu Beginn ihrer Karriere eine Bande von musikalisch hoch talentierten Außenseitern, was übrigens einige der großen 70er-Jahre-Bands auszeichnet. Taylor, Deacon und May sind im heutigen Jargon ein paar musizierende Nerds, als der aus Sansibar stammende Farrokh als Sänger zu ihnen stößt und sich kurze Zeit später Freddie Mercury nennt, um sich von seinem Elternhaus zu emanzipieren. Von da an geht es mit „Queen“ steil bergauf. Erfolg oder Misserfolg ist in den ersten Jahren der Band keine drängende Frage. Ihr Meisterwerk „A Night At The Opera“ ist das Ergebnis eines kreativen Multiexzesses, der sehr schön im Film inszeniert ist, und beschert ihnen den weltweiten Durchbruch. Doch Freddie lernt durch das ständige Touren seine Homosexualität kennen und gesteht sie schließlich seiner Verlobten Mary Austin, die fortan „nur noch“ seine beste Freundin ist.
Seine Homosexualität wird dennoch immer mehr zum Problem, aber nicht wegen gesellschaftlicher Ablehnung (Mercury hat sich nie öffentlich dazu bekannt), sondern weil sie einen Keil zwischen ihn und den übrigen Bandmitgliedern treibt, die alle ein mehr oder weniger gesittetes Familienleben führen. Zudem gilt er als das Zugpferd der Band und ihm wird von verschiedenen Seiten eine Solokarriere nahegelegt. So fühlt er sich immer häufiger zu Alleingängen genötigt und droht sich zwischen zahlreichen flüchtigen Liebschaften und der intensiven Arbeit an seiner Solokarriere selbst zu verlieren.
Erst als Mary Austin ihn anfleht, mit Queen den Auftritt beim Live-Aid zu spielen, wird ihm klar, dass er kein Einzelgänger ist und seine Bandkollegen braucht. Die verzeihen ihm prompt und Queen spielen eben jenen legendären Gig, der sie für den Rest seines Lebens zusammenschweißt. Denn inzwischen weiß er, dass er an AIDS erkrankt ist und nicht mehr lange zu leben hat. Das Ende des Films legt nahe, dass die verbleibenden Jahre für ihn glückliche gewesen sind, in denen er noch zwei Alben mit Queen veröffentlichen und außerdem eine langjährige Beziehung mit seinem Freund Jim Hutton führen konnte.
Diese Geschichte erzählt der Film und sie muss recht nahe an die Wirklichkeit heranreichen. Er beschreibt das Leben eines Mannes, der als begnadeter Musiker alles erreicht hat und schließlich trotz der tödlichen Krankheit im Kreise seiner Band, seiner Freunde und seiner Familie sein Glück gefunden hat. Wer glaubt, dies sei dramaturgische Übertreibung, muss nur einmal in Freddies Gesicht beim Original-Live-Aid-Konzert sehen, die Queen-Platten der letzten Phase anhören und dann weiß er, dahinter steckt eine tiefe Wahrheit. Der Film erzählt das, was die Band in Mercurys letzten Jahren immer wieder andeutete, berühmtestes Beispiel ist der schon angesprochene Song „Innuendo“ (Anspielung), „I‘m going slightly mad“ und „The Show must go on“. Wahrer kann eine erzählte Geschichte meiner Meinung nach nicht sein und das macht den Film zu einem besonderen Kunst- und Meisterwerk in der Reihe der Musikbiographien. Pflichtprogramm!
(gepostet: 9.11.2018)
2 Umsatzsteuerbefreit gemäß § 19 UStG (Kleinunternehmerregelung)
